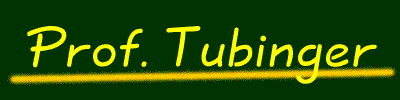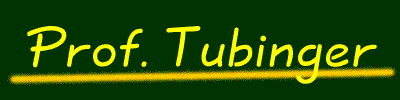|
Plädoyer für die Direkteinspritzung
In diesem Manuskript wird der Weg des Tons von seinem Ursprung bis zu seinem
Bestimmungsort verfolgt und Wege aufgezeigt, diesen Weg möglichst
verlustfrei zu gestalten. Dabei wird sich herausstellen, daß die Technik inzwischen
so weit fortgeschritten ist, daß auch Ansätze, die von vielen noch als
"unkonventionell" bezeichnet werden dürften, eine nähere Betrachtung
verdienen.
Einleitung
Heutzutage wird häufig ein großer Aufwand getrieben, um musikalische
Darbietungen dem Auditorium in guter Qualität zu Gehör zu bringen -
wobei
heutzutage wohl den Zeitraum der letzten 30 Jahre mit einschließt. Ein
erheblicher Anteil dieses Aufwands besteht in der Aufgabe, das Signal vom Ort
seiner Entstehung bis zum Ort seiner Wahrnehmung zu transportieren.
Der moderne Musiker, namentlich der Gitarrist, greift häufig auf
elektrisches
Gerät aller Art zurück, um den vom Instrument erzeugten Klang zu
verfremden und
ihm erst den für diese Art der Musik charakteristischen Klang zu geben -
vor
allem wenn es um sogenannte "un-unplugged"-Aufführungen geht. Die Rede ist
natürlich vom Gitarrenverstärker. Somit ist der Ort der Entstehung
des Signals
zweifach zu betrachten: auf der einen Seite darf sicherlich die Gitarrensaite
als Ort der Entstehung des Gitarrentons angesehen werden, auf der anderen Seite
entsteht aber erst mit Hilfe des Gitarrenverstärkers der typische Ton, so
daß
man auch den Lautsprecher dieses Verstärkers als Ort der Entstehung
ansehen muß.
Zwar
sind die Ohren des einzelnen Zuhörers zumeist gleichzeitig mit
gleichbleibendem Abstand voneinander an einem definierbaren Ort, so daß
man
diesen Ort der Wahrnehmung als singulären Punkt betrachten darf. Allerdings
existieren im Idealfall mehrere dieser Zuhörer, und somit haben wir es mit
sehr
vielen Orten der Wahrnehmung zu tun, die sich mehr oder weniger
gleichmäßig
über den gesamten Saal verteilen. Es gibt zumeist einen
"repräsentativen
Zuhörer", den sogenannten "Mann am Mixer". Weiterhin ist ein ganz
besonderer
Zuhörer zu berücksichtigen, nämlich der Musiker selbst.
(Exkurs:
Der gute Professor ist als ein Mensch, der sich der Wissenschaft verschrieben
hat, nicht an den marginalen Unterschieden der Geschlechter interessiert, und
so mag es man ihm nachsehen, daß er eine partiarchalisch geprägte
Sprache
verwendet - er sagt "Mann am Mixer", meint aber natürlich "Frau oder Mann
am
Mixer oder an der Mixerin". Wir wollen nicht in den Verdacht geraten,
frauenfeindlich zu sein, und bitten die geneigte Leserin, männlich
dominierte
Formulierungen im Kopf durch geeignete geschlechtsneutrale oder je nach
Belieben auch weiblich dominierte Formulierungen zu ersetzen.
Ende des Exkurses.)
Wir haben es hier also mit verschiedenen Personen zu tun: Der Musiker, der
Mischermensch, und "der Zuhörer". Da jeder von ihnen an einem anderen Platz
steht, hört jeder auch was anderes - trotzdem sind alle
gleichermaßen am
Gelingen oder Scheitern eines Konzerts beteiligt. Wir werden uns daher in diese
Personen versetzen, um zu untersuchen, was die betreffende Person jeweils
hört.
Bisher
war von sogenannten Live-Anwendungen die Rede. Nun, im Studio hat man sicher
mehr Möglichkeiten und mehr Zeit, beliebige Verfahren anzuwenden, um den
besten
Ton auf's wie auch immer beschaffene magnetische Material zu bannen. Es mag
Leser (und Leserinnen - zum letzten Mal mit separater Anrede, ab jetzt dann wie
oben im Exkurs besprochen) geben, die beliebig viel Zeit im Studio haben, die
beliebig viel Geld für Equipment und Studio-Stunden ausgeben können.
Diese
Personengruppe wird dem vorliegenden Manuskript nur wenig abgewinnen
können.
Alle anderen mögen die folgenden Betrachtungen sinngemäß auf
Studio-Anwendungen
übertragen, äh, extrapolieren.
Betrachten wir zunächst ein konventionelles Setup mit
Gitarrenverstärker/Box
bzw. Koffer-Amp und Mikrofon. Dabei müssen wir vorab noch einige Dinge
erwähnen, die zwar für die Klangerzeugung wichtig, aber nicht
Gegenstand dieses
Manuskripts sind.
Da
steht der Gitarrist, hat sein Mahagonibrett umgeschnallt, ein Kabel
eingestöpselt, das Signal wandert durch das Kabel, diverse
Effektgeräte in den
Amp, wird dort auf mannigfaltige Weise verbogen und aus dem
Gitarrenlautsprecher ertönt schließlich ein Geräusch von der
Sorte, die die
jungen Leute heutzutage mögen.
(Exkurs Tonerzeugung:
Wir sind uns bewußt, daß die Tonerzeugung nicht erst im
Gitarrenverstärker
beginnt. Wenn die Saite angeschlagen wird, kommt es zunächst einmal darauf
an,
welche Art von Resonanz sie erfährt. Das alles hat sehr viel mit den
verwendeten Hölzern und Fertigungsmethoden zu tun und genausoviel mit den
Fingern des Gitarristen und ist zunächst ein rein akustisches
Phänomen. Wobei
Mahagoni hier je nach Vorliebe natürlich auch durch Esche, Erle, Ahorn,
Pappel,
Linde und dergleichen mehr ersetzt werden kann.
Man mache sich die Bedeutung des akustischen Aspekts für die
Charakteristik
des Klangs auch einer elektrischen Gitarre bitte bewußt. Erst danach wird
durch
die Tonabnehmer und die elektrische Schaltung ein elektrisches Phänomen.
Der Verlauf des am Ausgang der Gitarre liegenden Signals bis zum Eingang des
Gitarrenverstärkers soll hier nicht weiter betrachtet werden. Wir sind uns
aber
bewußt, daß auch das verwendete Kabel sowie natürlich die im
Signalweg
eingeschleiften Effekte sehr wohl einen Einfluß auf das Signal haben,
welches
schließlich den Gitarrenverstärker erreicht. Diese Aspekte sind aber
nicht
Bestandteil der aktuellen Betrachtung.
Ende Exkurs Tonerzeugung.)
SM57 oder "Was hört das Mikrofon?"
Das handelsübliche Mikrofon wird in geeigneter Art und Weise auf den
Gitarrenlautsprecher gerichtet (was nun genau die geeignete Art und Weise ist,
führt gelegentlich zu handfesten Streits zwischen den verschiedenen
für das
Gelingen eines gelungenen Konzerts verantwortlichen Personen und soll hier
nicht weiter erörtert werden).
Das Mikrofon hört natürlich den in der Nähe befindlichen
Lautsprecher besonders
gut. Darüber hinaus hört es bei Systmen mit mehreren Lautsprechern
auch noch
die benachbarten Chassis. Zwar etwas leiser, aber immerhin mit einer minimalen
Laufzeitverzögerung bedingt durch die Zeit, die der Schall zum
Zurücklegen der
etwas größeren Distanz benötigt. Unter anderem dies ist der
Grund, weshalb
Boxen mit mehreren Chassis sich etwas 'voller' anhören, es findet eine
Signalvervielfachung statt. Wer nun glaubt, mit dieser Methode gleich ein
Slapback-Delay realisieren zu können, irrt - so groß sind die
Laufzeitunterschiede nicht. Aber immerhin ist hier bereits eine potenzielle
Quelle für "Mulm".
Nun
findet aber diese Mikrofon-Lautsprecher-Paarung nicht in einem schalldicht
isolierten Raum statt, sondern auf offener Bühne. Das Mikrofon hört
also noch
ein paar andere Geräusche aus der Umgebung. In allererster Linie - die
Snare.
Dazu kommt jede Menge weiterer Direktschall vom Schlagzeug, aus anderen
Instrumenten-Amps, Trittschall und so weiter. Die dazugehörigen indirekten
Anteile bedingt durch Relexionen nicht zu vergessen, kann je nach
Raumdämpfung
in der Größenordnung von 20% liegen. Und dann noch reichlich
Sekundär-Schall
aus der Front-PA und aus den Monitoren.
Das alles bietet nahezu ideale Voraussetzungen für die Entstehung von
Sound-Matsch. Bei Verwendung einer Speaker-Simulation, der Direktabnahme also,
sind diese Nachteile natürlich nicht gegeben, doch dazu später mehr.
Was hört der Musiker?
Vieles von dem, was oben zum Mikrofon gesagt wurde, gilt im übertragenen
Sinne
auch für den Musiker. Er hört seinen Amp ein bißchen leiser im
Vergleich zum
Mikrofon (es sei denn, er klebt die ganze Zeit mit seinen Ohren an der
Frontbespannung der Box), und er hört die Monitorboxen etwas lauter. Da er
seinen Standort gelegentlich wechselt (eine Unart, der die meisten Gitarristen
ab und zu frönen), verschieben die Verhältnisse sich auch schonmal,
aber auch
der Musiker selbst hört ein Gemisch aus Amp-Signal, indirektem Schall und
PA-Signal.
Man darf dies bitte nicht mit einer typischen Proberaum- oder
"Ich-kauf-mir-heute-einen-Amp"-Szenerie verwechseln. Dort hört man
nämlich nur
den Amp, und nicht etwa ein Gemisch aus Amp-Sound und PA-Ton. Es sind
übrigens
diese typischen "der alte Mann und der Amp" Situationen, in denen ein
"richtiger" Gitarrenverstärker mit "richtiger" Box dazu neigt, besser
beurteilt
zu werden als z.B. ein POD über ein lineares System. Hier hat der "echte"
Amp
klare Vorteile, er klingt direkter, druckvoller. Der geneigte Leser mache sich
aber bitte klar, daß diese Situation auf der Bühne aus den genannten
Gründen
nicht reproduzierbar ist.
Was hört der Mischer?
Wie der Name schon sagt: Ein Gemisch! Bevor wir tiefer in diese Betrachtung
einsteigen, rekapitulieren wir einmal eine typische Soundcheck-Situation.
Der Gitarrist hat sich sein Arbeitsgerät umgehängt und überlegt
gerade, ob er
jetzt den Gitarristen der anderen Band beeindrucken will oder stattdessen
lieber dessen nette Freundin und was man denn zu diesem Zwecke spielen sollte.
Der Mischer verteilt seine Finger strategisch über sein Pult und blickt den
Gitarristen erwartungsvoll an.
Gitarrist:
- Spielt ein paar Töne.
Mischer:
"Mach mal Deinen Amp ein bißchen leiser."
Gitarrist:
- Wendet sich seinem Amp zu und tut so, als ob er dran drehen würde. Dann
spielt er wieder ein paar Töne.
Mischer:
"Noch leiser, bitte."
Gitarrist:
- Wendet sich erneut seinem Amp zu und dreht den Master Volume etwas runter.
Spielt wieder, wobei er inzwischen nicht mehr an den anderen Gitarristen denkt
oder an dessen Freundin, sondern nur noch daran, den Amp nachher möglichst
unauffällig wieder lauter zu stellen.
Mischer:
"Noch ein kleines bißchen leiser!"
Gitarrist:
- Dreht den Master noch ein ganz kleines Stückchen zurück, wobei er
darum
bemüht ist, nicht zu weit zu drehen.
(Anmerkung: Das ist auch nicht so leicht. Die üblichen Potis sind für
diesen
Zweck relativ schwergängig, und man hat leicht eine hundertstel
Bogensekunde zu
weit zurück gedreht. Die Industrie sollte sich dieses Problems endlich
annehmen
und Mastervolume-Potis mit Untersetzungsgetriebe im Drehknopf einbauen.)
Mischer:
"Spiel mal was." Denkt dabei: "Mach ich ihn halt am Pult was leiser". Stellt
einen passablen Grund-Sound ein. "Nimm mal den Hall ein bißchen raus!"
Gitarrist:
- Nimmt den Hall ein bißchen raus, merkt sich aber, wo der vorher stand.
Und so weiter. Während die nette Freundin des anderen Gitarristen sich auf
die
Suche nach einem Kaffee (oder der Toilette, je nach Tagszeit) begibt, kommt
schließlich ein ganz ordentlicher Ton zustande. Wobei ganz ordentlich
natürlich
relativ ist, denn je nach Bühnengröße kommt es hier
tatsächlich schon zu
nennenswerten Laufzeitunterschieden zwischen den verschiedenen Schallquellen.
Matsch-Potenzial also mal wieder.
Der Mischer
hört nun eine Mixtur aus Amp-Sound und Front-PA-Sound, und diese Mischung
klingt an genau seinem Standort auch ganz gut. Da Mischer-Leute im Verlauf des
Abends im Gegensatz zu Gitarristen eher selten ihren Standort wechseln, bleibt
das auch so. Wenn man mal von der durch Anwesenheit von Publikum geänderten
Akustik absieht, aber das ist bei Direkteinspritzung genauso und soll daher
nicht weiter ausgeführt werden.
Wir gehen dabei praxisgerecht von einem "ganz normalen" Mischermenschen aus,
der sein Handwerk versteht, also kein Dilletant ist - aber auch nicht im
Verdacht steht, ein absolutes Ton-Genie zu sein. Nachdem auch die anderen
Musiker ihren Soundcheck abgeschlossen haben und auch die Monitor eingestellt
sind, ist dieses Kapitel beendet.
Und das Ohr des Volkes?
Das Volk steht nun aber kreuz und quer im ganzen Raum verteilt (der Professor
sucht sich gern sein Plätzchen in der Nähe des Mischpults, nicht um
den
Mischermenschen vollzulabern, sondern weil die ganzen Lämpchen immer so
schön
blinken und außerdem der Ton dort dazu neigt, in die Nähe dessen zu
kommen, was
gewollt ist). An jedem Platz klingt es anders. Weil die Anteile zwischen
direktem Amp-Sound und abgemiketem PA-Sound sich permanent verschieben.
Und dann passiert plötzlich etwas Seltsames: Der Gitarrist, der vorher beim
Soundcheck schön vor seinem Amp stand, weil er ja ständig am
Master-Volume
drehen mußte, beginnt unvermittelt, sich zu bewegen, wechselt seine
Position
auf der Bühne, und - bratz - der volle Amp-Sound, nunmehr ungedämpft,
bahnt
sich seinen Weg ins Publikum. Der Mann am Mischer hat gerade ein anregendes
Gespräch mit der netten Freundin des Gitarristen der anderen Band
angefangen
und braucht einige Zeit, um rauszufinden, was ihn stört. Irgendwann merkt
er es
und nimmt die Gitarre ein bißchen zurück. Am Mixer, versteht sich,
an den Amp
kommt er ja nicht ran. Dadurch ist die Gitarre jetzt vorne im Saal viel zu laut
und hinten im Saal viel zu leise. Denn wie wir alle wissen, ein Gitarrenamp ist
nicht für die Überbrückung langer Distanzen gebaut.
Nun
wendet der Gitarrist sich seiner Fußboden-Menagerie zu, um zum Solo zu
schreiten. Dadurch steht er wieder vor seinem Amp und damit im Schall. Der
Mischermensch ist gerade von dem Gitarristen der anderen Band in einen
völlig
überflüssigen Streit verwickelt worden und hört so auch nicht,
wie der
Gitarrist oben auf der Bühne sich zweimal verspielt. Später wird man
ihm sagen,
er sei beim ersten Solo so gut wie nicht zu hören gewesen.
Geschichten, wie nur Prof. Tubinger sie sich ausdenken kann? Weit gefehlt! So
ist das Leben. Der Professor hat sogar schon Bands gesehen, die zur Umgehung
all dieser Probleme mit dem Preamp Out des Kofferamps direkt ins Pult gegangen
sind - leider mit der Folge eines näselnden, dünnen Sounds.
Speaker-Simulation
Schon seit längerem gibt es sogenannte Speaker-Simulationen; zumeist
handelt es
sich dabei um frequenzgangkorrigierte und auf Line-Pegel gebrachte Signale. Ein
Lautsprecher ist ein komplexes System, so komplex, daß z.B. die Firma
Celestion
behauptet, daß man nie einen Gitarrenlautsprecher wird simulieren
können.
Aber wenn Dr. Marlboro behauptet, daß die Zigarrette nicht
gesundheitsschädlich
ist, oder der rumänische Wirtschaftsminister, daß von
rumänischen Bergwerken
keine Gefahr für die Donau und andere Flüsse ausgeht, dann ist man
schon
geneigt, eine gewisse Parteilichkeit zu unterstellen. Insofern darf man auch
dieses Statement von Celestion (erschien als Zitat im LINE6 Lup Forum)
relativieren. Diese Zivilisation hat es vor mehr als 30 Jahren geschafft, der
Schwerkraft ihres Heimatplaneten zu entfliehen, und gemessen an der
Komplexität
allein dieser Aufgabe erscheint die Simulation eines Gitarrenlautsprechers eher
trivial. Es kann also nicht um die Frage gehen, ob derlei heutzutage
möglich
ist, sondern nur um die Frage nach der Qualität dieser Umsetzung.
Ein
Gitarrenlautsprecher hat einen charakteristischen Frequenzgang, der deutlich
von dem z.B. einer HiFi-Box abweicht. Einfache Speaker-Simulationen bilden
diesen Frequenzgang mit Hilfe geeigneter Filter nach. Und das ist bereits als
passive Schaltung (also ohne Stromversorgung) möglich. Der Klang solcher
Systeme ist schon beachtlich und definitiv dem oben erwähnten Szenario
"Preamp
Out des Kofferamps direkt ins Pult" vorzuziehen. Da eine solche Schaltung alle
aufgeführten Nachteile der Mikrofon-Abnahme eliminiert, wird sie
häufig bereits
so gut klingen, daß sie im direkten Vergleich locker gewinnt und daher
bevorzugt wird.
Wichtig dafür ist allerdings, daß ein solcher Vergleichstest
tatsächlich auch
in einer Halle, mit PA, durchgeführt wird und nicht in der bereits
angeführten
Proberaum-Situation.
Ein Gitarrenlautsprecher hat aber ein paar mehr charakteristische Eigenschaften
als "nur" seinen Frequenzgang. Beispielsweise federn auch hart aufgehängte
Chassis ein bißchen nach und so beeinflußt ein einzelner, tiefer,
lauter Impuls
die darauffolgenden Töne. Und die Zweierbeziehung "Mikrofon-Box" bringt
weitere
Aspekte mit ein (Stichwort Mikrofon-Plazierung).
Hier
ist der Ansatzpunkt für modernere Speaker-Simulationen wie z.B. die
A.I.R.-Schaltung von LINE6. Man kann das komplexe Gebilde
"Gitarrenlautsprecher" sicher auch mit analoger Technik noch besser simulieren,
als das derzeit der Fall ist. Die Digitaltechnik hat demgegenüber aber den
Vorteil, daß "alles nur" Software ist und daher leichter zu
implementieren.
Zumal wenn das Signal wie z.B. im POD sich bereits in der digitalen Domäne
aufhält und dann "nur" noch nachbearbeitet werden muß.
Das ist übrigens auch der Grund, weshalb die A.I.R.-Schaltung bei den
LINE6-Geräten nicht für die unterschiedlichen Ausgänge getrennt
aktivierbar
ist: Dazu müßte es zwei verschiedene Wege raus aus der digitalen
Domäne geben
und somit zusätzliche A/D-Wandler. Aus dem gleichen Grund hat der POD
keinen
Einschleifweg: Auch hier wären zusätzliche Analog/Digital-Wandler
erforderlich.
Die Wandler des POD sind zwar bei weitem nicht allererste Sahne (obwohl sie DIN
45500 locker erreichen würden), aber Wandler gehören generell zu den
etwas
teureren Bauteilen und werden daher von allen Herstellern eher
zurückhaltend
eingesetzt.
Fazit
Der POD mag einem Verstärker aus "Fleisch und Blut" unterlegen sein, wenn
es um
Test-Szenarien im stillen Kämmerlein geht. Draußen auf der
Bühne, bei all den
Nachteilen, die der Mix aus Direktschall und Mikrofon/PA-Schall mit sich
bringt, kann er sich gelegentlich als überlegen erweisen.
Was nutzt ein Super-Amp, der 100% gut klingt, wenn von diesen 100% Qualität
nachher nur 40% Qualität beim Publikum ankommen? Wenn man dann
andererseits dem
POD zugestehen will, daß er auch nur 70% der Klangqualität eines
"echten"
Verstärkers erreicht, aber diese 70% tatsächlich auch voll das
Publikum
erreichen - dann meint der Professor, 70% ist mehr als 40%.
Dabei soll hier keinesfalls nur vom POD oder von LINE6 die Rede sein. LINE6 hat
zwar eine Vorreiter-Rolle angenommen, aber andere werden folgen. Und die
Überlegenheit der Technik der Direkteinspritzung wird nicht mehr nur mit
einem
Hersteller verbunden sein.
Tubinger
|